Zwischen Anpassung und Auflehnung: Mouloud Feraoun im literarischen Feld
Kremer, Ines
Produktnummer:
182d7f3e5b0e9a4d10a380bfaae9f7cb30
| Autor: | Kremer, Ines |
|---|---|
| Themengebiete: | Kabylei Mouloud Feraoun Sozialkritik maghrebinischer Roman postkoloniale Literatur |
| Veröffentlichungsdatum: | 07.04.2025 |
| EAN: | 9783989400610 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 272 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier |
Produktinformationen "Zwischen Anpassung und Auflehnung: Mouloud Feraoun im literarischen Feld"
Mouloud Feraoun (1913-1962) gilt heute als ‚Gründervater‘ des maghrebinischen Romans in französischer Sprache. Dennoch blieben in seiner Rezeption wesentliche Aspekte seiner Texte unbeachtet, da sie als literarisch wenig bedeutsam und zugleich apolitisch wahrgenommen wurden. Hier setzt die vorliegende Arbeit an, die das zentrale Anliegen von Feraouns Œuvre, die soziale Frage im (post)kolonialen Kontext, in den Vordergrund rückt. Seine Sozialkritik, die bislang wenig zur Kenntnis genommen wurde, wird durch Komik und Ironie wirksam und richtet sich unter anderem gegen die althergebrachte Geschlechterhierarchie. Damit weisen Feraouns Romane auf eine maßgebliche Entwicklung der algerischen Literatur in französischer Sprache voraus. Die exemplarische Analyse seiner Zusammenarbeit mit Akteur_innen des literarischen Feldes sowohl im kolonialen Algerien als auch in Frankreich, darunter Emmanuel Roblès und Albert Camus, lässt zudem die Konturen eines algerischen Teil-/Binnenfeldes hervortreten, dessen beginnende Autonomisierung in den 1940er und 1950er Jahren anzusetzen ist. INHALT 1. Einleitung 1 2. Von Hierarchie und Deutungshoheit – methodische Vorüberlegungen zum Konzept des literarischen Feldes 9 2.1 Feldtheoretische Aspekte 9 2.2 Das Konzept des literarischen Felds im internationalen Kontext 18 2.3 Sprache und Kolonialdiskurs 25 3. Historische Kontextualisierung: Transformationen im champ politique Algeriens 30 3.1 Von der Kolonisation zur Unabhängigkeit 30 3.2 Zur condition féminine im kolonialen Algerien 33 3.3 Sprach- und Bildungspolitik: das uneingelöste Versprechen der mission civilisatrice 35 3.4 Aspekte der kolonialen Kultur- und Buchpolitik 39 4. Der Einfluss externer Faktoren auf Feraouns Positionierung im literarischen Feld 42 4.1 Feraouns Zusammenarbeit mit Verlagen und Zeitschriften 43 4.2 Die vermittelnde Bedeutung von Emmanuel Roblès 52 4.3 Textbearbeitung und -kürzung 57 4.4 Politische Stellungnahmen 66 4.4.1 Feraouns Journal – Zeitzeugnis und pazifistisches Manifest 67 4.4.2 Feraoun und Camus 71 4.4.3 Feraouns Definition von ‚algerischer? Literatur 79 4.5 Das Bemühen um Auszeichnung: Literaturpreise 84 Zwischenbilanz 88 5. Textinterne Strategien und erzähltechnische Voraussetzungen 91 6. Die Aneignung und Adaption von Roman und Autobiografie 94 6.1 Die Aneignung und Adaption des Romans 94 6.2 Die Aneignung und Adaption autobiografischer Erzählkonventionen 96 6.2.1 Autobiografisch inspiriertes Schreiben als Mangel an Literarizität? 97 6.2.2 Autobiografisch inspiriertes Erzählen als explizite Einschreibung in das französische champ littéraire 98 6.2.3 Autobiografisch inspiriertes Erzählen zwischen Wortergreifung und Identitätskonstruktion 101 6.2.4 Autobiografische Individualität vs. kollektive Stimmen-, Rede- und Sprachenvielfalt 102 6.2.5 Das Spiel mit autobiografischen Erzählkonventionen 104 6.2.6 Die metapoetische Reflexion der Autobiografie in der Herausgeberfiktion 106 6.3 Journal intime und Polyphonie 110 7. Von der Einschreibung zur Gegenschrift – Intertextualität als textinterne Strategie in Feraouns Romanen 113 7.1 Intertextuelle Verweise auf den französischen und internationalen Literaturkanon in Le fils du pauvre 113 7.1.1 Partizipation im Modus des ‚Namedropping‘ 114 7.1.2 Partizipation als thematisches und architextuelles ‚Weiterschreiben‘ 119 7.1.3 Transformation im Modus der Distanzierung 122 7.1.4 Intertextuelle Verweise auf zeitgenössische Literatur aus dem kolonialen Algerien in Le fils du pauvre 124 7.1.5 Zwischen Partizipation und Transformation: die Schlüsselfiguren des instituteur indigène 125 7.1.6 Konfrontatives ‚Gegenschreiben‘ und Subversion des kolonialen Zivilisierungsdiskurses 133 7.1.7 Verweise auf die kabylische Erzähltradition in Le fils du pauvre 139 7.2 Intertextualität in La terre et le sang 142 7.3 Intertextualität in Les chemins qui montent 148 7.3.1 Autoreferenzialität 149 7.3.2 Die intertextuelle Auseinandersetzung mit Albert Camus’ L’Étranger (1942) 152 7.3.3 Verweise auf die kabylische Erzähltradition 154 8. Die Konfrontation des Französischen mit dem Tamazight 158 8.1 Das Tamazight als Referenzrahmen: Orientierung der Rezipient_innen durch glossing und direkte Übersetzung 158 8.2 Irritation der Rezipient_innen durch fehlendes glossing und Verfremdung 167 8.3 Die Literatursprache als Fremdkörper im ‚eigenen‘ Text? 172 9. Die Frage nach kultureller Identität 177 9.1 Kulturelle Identität und sozialer Aufstieg in Le fils du pauvre 178 9.2 Identitätswandel und Essenzialismus in La terre et le sang 184 9.3 Zwei Perspektiven auf Identität in Les chemins qui montent 192 9.3.1 Amer n’Amers journal als Zeugnis einer Identitätskrise 192 9.3.2 Dehbias Perspektive: Religiöser Glaube als wesentliches Identitätsmerkmal 198 10. Sozial- oder Kolonialkritik 201 10.1 Die Internalisierung kolonialer Stereotype und ihre ironische Subversion 202 10.2 Die Omnipräsenz des Rassismus 204 10.3 Armut als Folge von Kolonisation 206 10.4 Sozialkritik am Beispiel der Geschlechterrollen 212 10.4.1 Le fils du pauvre 213 10.4.2 La terre et le sang 218 10.4.3 Les chemins qui montent 223 11. Der vielfältige Referenzraum Mouloud Feraouns 230 Bibliografie 234
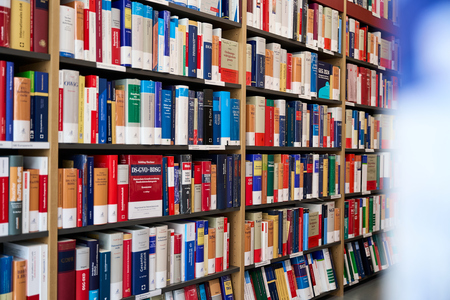
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen
