Wonders of the Modern World
Produktnummer:
181c31c60e99964aa88ab6dec9eeb3a4a4
| Themengebiete: | Architekturdiskurs Forschungsprojekt Identitätspraktiken Kumbh-Mela-Fest Moderne Architektur Rituale Spirituelle Orte TU Wien religiöse Bauwerke |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 03.04.2025 |
| EAN: | 9783931435882 |
| Auflage: | 1 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 208 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Arch+ |
Produktinformationen "Wonders of the Modern World"
Dialektik der Aufklärung im Zeitalter der Disruption Text: Anh-Linh Ngo Warum ein Heft über die Wunder der modernen Welt? War die Aufklärung nicht angetreten, die Welt zu entzaubern und von Mythen und Wundern zu befreien? Und warum eine Ausgabe über Architekturen für archaisch anmutende Massenrituale – in einer Zeit, in der sich die Massen den Sirenen der Gegenwart aussetzen, ohne sich, wie einst Odysseus, zum eigenen Schutz am Mast ihres Schiffes festzubinden? Die Antwort ist einfach: Weil diese Zeugnisse verdrängter kollektiver Sinnstrukturen weiterhin existieren. Und weil wir zugleich eine beispiellose Erosion gemeinschaftlicher Regeln und Identitätspraktiken erleben. Vor diesem Hintergrund erinnert dieses Heft daran, dass es eine der zentralen Aufgaben der Architektur ist, Gemeinschaft zu konstituieren. Das Forschungsprojekt Wonders of the Modern World, geleitet von Pier Paolo Tamburelli und Anna Livia Friel an der TU Wien, lenkt den Blick auf diese unübersehbaren, im Architekturdiskurs jedoch unsichtbaren Relikte symbolischer Ordnungen. Es stellt die Frage: Welche Lehren bergen sie für eine Neukonstituierung des Gemeinschaftlichen? Was können wir – im Positiven wie im Negativen – von Orten lernen, die Millionen von Menschen anziehen? Was lehren uns die Batu-Höhlen in Kuala Lumpur, der Grand Magal von Touba, aber auch das Sambódromo in Rio de Janeiro oder das Oktoberfest in München? Tamburelli beschreibt in seinem einleitenden Essay, wie die moderne Architektur durch ihre Reduktion auf Funktionalität und Rationalität ihre rituelle Dimension verlor. Dabei war Architektur historisch nie nur funktional, sondern stets auch ein Medium sozialer Bindung, der Identitätsstiftung und der Repräsentation von Machtverhältnissen. Monumente, religiöse Bauwerke und rituelle Orte verkörperten kollektive Werte und gesellschaftliche Ordnungen. Mit dem Siegeszug der Moderne verschwanden diese symbolischen Funktionen zunehmend – während die dahinterliegenden Machtstrukturen meist unangetastet blieben. Die hier präsentierte Studie zeigt, dass auch moderne, hyperindividualistische Gesellschaften weiterhin architektonische Formen benötigen, die Zugehörigkeit sowie kulturelle und politische Identitäten stiften. Damit weist sie auf einen Grundwiderspruch der Moderne hin: das Spannungsverhältnis zwischen dem Streben nach individueller Freiheit und der Notwendigkeit stabilisierender gesellschaftlicher Strukturen. Nachdem es über Jahrhunderte hinweg erfolgreich Autoritäten, Normen und Institutionen erschüttert hat, um das Individuum aus selbstverschuldeter Unmündigkeit zu befreien, steht das kritische Projekt der Aufklärung nun vor einer neuen Frage: Was geschieht, wenn dieser Prozess der Dekonstruktion, der ein hohes Maß an individueller Freiheit hervorgebracht hat, keine Grenzen mehr kennt? Wenn der Individualismus sich völlig von gesellschaftlichen Ordnungen löst? Diese Frage ist keineswegs abstrakt. Wir erleben derzeit, wie der enthemmte Individualismus in eine libertäre Ideologie mündet, die nicht mehr auf Emanzipation oder gesellschaftlichen Fortschritt zielt, sondern auf Disruption als Selbstzweck. Besonders sichtbar wird dies in den USA, wo der Kult des autonomen Individuums das Regierungshandeln prägt: Politische Institutionen verlieren rasant an normativer Kraft; das System von Checks und Balances – und mit ihm die Kritik als Instrument der Reform von Institutionen und der Einhegung von Macht – wird vor unseren Augen abgeschafft. Skrupellosigkeit und Lügen setzen sich durch. Der Hyperindividualismus hat ein Stadium erreicht, in dem Autonomie nicht länger der Emanzipation dient, sondern zur Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung wird. Damit sind wir der dialektischen Struktur der Aufklärung auf der Spur, die Theodor W. Adorno und Max Horkheimer herausgearbeitet haben: „Wir hegen keinen Zweifel […], daß die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Jedoch glauben wir, […] daß der Begriff eben dieses Denkens, nicht weniger als die konkreten historischen Formen, die Institutionen der Gesellschaft, in die es verflochten ist, schon den Keim zu jenem Rückschritt enthalten, der heute überall sich ereignet.“1 Die Aufklärung lebt von der Offenheit des Denkens und der Wandelbarkeit institutioneller Strukturen. Doch genau diese Prinzipien stehen in einem dialektischen Widerspruch zu der Stabilität, die ihre Entfaltung erst ermöglicht. In der „instrumentellen Vernunft“ des aufgeklärten Denkens liegt darüber hinaus der Keim seiner eigenen Verkehrung. Was als Entzauberung der Welt begann, schlug selbst in eine Mythologie der Rationalität um – eine Ordnung, in der der Mensch sich nicht mehr als handelndes Subjekt, sondern als bloßes Rädchen in einem zunehmend totalitären System wiederfindet. Die Rationalität der Moderne dient nicht mehr der Befreiung, sondern dem reibungslosen Funktionieren der bestehenden Verhältnisse – durch neue, subtilere Formen der Kontrolle und Unterwerfung. Adornos und Horkheimers dystopische Analyse der Ambivalenz des technischen und sozialen Fortschritts sowie der Herrschaft der Rationalität über die Natur, verfasst auf dem Höhepunkt des nationalsozialistischen und stalinistischen Totalitarismus,2 reicht angesichts der Klimakrise und des erstarkenden rechtslibertären Technikglaubens bis in die Gegenwart. Der zeitgenössische Totalitarismus des libertären Kapitalismus besteht darin, individuelle Freiheit und Marktfreiheit als Einheit zu verabsolutieren. Die unablässigen Tabubrüche von Trump, Musk & Co. haben Methode: Die Regelverstöße richten sich gegen die Idee von Gesellschaft selbst, die auf Normen angewiesen ist. Genau diese enge Verbindung zwischen Regeln und Gesellschaft beschrieb Michel Foucault, als er betonte, „dass der Mensch nicht mit der Freiheit, sondern mit der Grenze und der Linie des Unübertretbaren beginnt“.3 Erst die Anerkennung von Normen und Grenzen macht das Individuum zu einem sozialen Wesen. Indem sie jegliche Regeln als Einschränkung ihres individuellen Machtstrebens begreifen, verkörpern rechtslibertäre Figuren wie Trump und Musk das radikale „thinking outside the box“, das als Grundlage von Kreativität propagiert wird. Doch müssen wir nicht heute, angesichts der Angriffe auf die demokratischen Strukturen, mit Tamburelli fragen: Wie lässt sich wieder „inside the box“ denken? Wie können wir in der Politik, aber auch in der Architektur und anderen Bereichen, Regeln, Rahmen und Grenzen als Voraussetzung für Kreativität und Erneuerung verstehen – ohne in autoritäre Strukturen zurückzufallen? Die zentrale Herausforderung besteht darin, gemeinsame Regeln und Institutionen neu zu verankern – nicht als starres Bollwerk gegen Veränderung, sondern als vielfältige, flexible und resiliente Strukturen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren, ohne die Freiheit in der Gesellschaft zu opfern. Der wahre Fortschritt unserer Zeit liegt nicht in der rastlosen Grenzüberschreitung, der Zerschlagung des Bestehenden und der atemlosen Jagd nach dem Neuen, sondern in der Schaffung und Bewahrung nachhaltiger Strukturen – in kultureller, politischer und ökologischer Hinsicht. Es ist an der Zeit, nach Formen des Wandels zu suchen, die nicht in Zerschlagung und Abriss, sondern in Erneuerung münden – einer Erneuerung, die gemeinschaftliche Institutionen stärkt, ohne das Individuum zu entmündigen. Denn wahre Emanzipation erfordert Strukturen, die Freiheit nicht als Privileg einzelner, sondern als Grundlage einer gemeinsamen Zukunft garantieren. Dank Für die bereichernde Zusammenarbeit im Rahmen der Gastredaktion dieser Ausgabe danke ich Pier Paolo Tamburelli und Anna Livia Friel, allen weiteren Beteiligten am Forschungsprojekt und den Autor*innen. Für die schöne Umsetzung des Projekts danke ich dem ARCH+ Team, insbesondere Nora Dünser (CvD), Mirko Gatti (Projektleitung) und Victor Lortie (Englisches Lektorat). Für die vollständige Liste der Beteiligten siehe Impressum. 1 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung – Philosophische Fragmente, Frankfurt a. M. 1994, S. 3 2 Max Horkheimer und Theodor W. Adorno verfassten Dialektik der Aufklärung zwischen 1942 und 1944, die offizielle Erstveröffentlichung erfolgte 1947 im Amsterdamer Exilverlag Querido. 3 Michel Foucault: „Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werkes“, in: Ders.: Dits et Ecrits. Schriften in vier Bänden, Band I: 1954–1969, hg. v. Daniel Defert u. a., Frankfurt a. M. 2002, S. 544
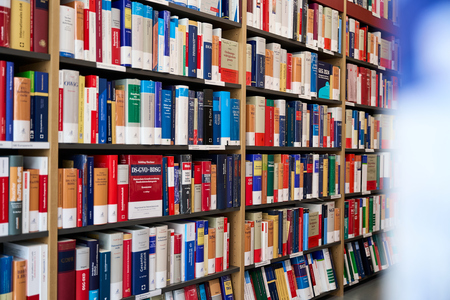
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen
