Wien/Roma - Agency For Better Living
Produktnummer:
188ae1d0350af64d7ca8bb4d1b84cfbe5a
| Themengebiete: | Architektur Commoning Rom Sozialer Wohnungsbau Venedig Architekturbiennale 2025 Wien Wohnungsfrage leistbarer Wohnraum Österreichischer Pavillon |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 27.05.2025 |
| EAN: | 9783931435899 |
| Auflage: | 1 |
| Sprache: | Deutsch Englisch |
| Seitenzahl: | 208 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Arch+ |
Produktinformationen "Wien/Roma - Agency For Better Living"
Zwei Städte Eine gemeinsame Suche nach dem besseren Leben Text: Anh-Linh Ngo Wie wollen wir künftig zusammenleben? Diese bis zur Floskelhaftigkeit wiederholte Frage gewinnt zunehmend an Dringlichkeit: Explodierende Mieten, stagnierende Einkommen, steigende Energiekosten, soziale Ungleichheit und klimatische Extreme setzen Europas Städte massiv unter Druck. Migration und geopolitische Krisen verschärfen diese Herausforderungen weiter. Formelle Planungsmechanismen stoßen an ihre Grenzen. In dieser komplexen Gemengelage wird das Thema Wohnen zur zentralen sozialen Aufgabe unserer Zeit. Viele europäische Städte schaffen es nicht, bezahlbaren Wohn- raum bereitzustellen, geschweige denn langfristig zu sichern. Doch das ist kein Zufall, sondern Ergebnis politischen Handelns, bei dem der Wohnraum den Marktkräften überlassen wurde. Statt gemeinwohlorientierter Steuerung bestimmen spekulative Finanzlogiken und kurzfristige Profitinteressen den Immobilienmarkt. Die Wohnungsfrage ist heute mehr denn je Schauplatz gesellschaftlicher Verteilungskämpfe. Wien – die Stadt der Fürsorge Wien sticht hier hervor. Die Stadt verfolgt seit über einem Jahrhundert eine Wohnbaupolitik, die Wohnraum als öffentliches Gut versteht. Durch langfristige Bodenpolitik, zweckmäßige Investitionen in Gemeindewohnungen und geförderten Wohnbau ist es gelungen, für breite Bevölkerungsschichten – einschließlich der Mittelschichten, die hinsichtlich der Wohnkosten immer stärker unter Druck geraten – leistbare Mieten zu garantieren. Die enorme Anzahl an städtisch verwalteten und geförderten Wohnungen trägt dazu bei, die Mieten nicht nur im Gemeindebau, sondern in der gesamten Stadt stabil zu halten. Ein Großteil der Wiener*innen lebt in unbefristeten Mietverhältnissen, oft mit Zugang zu gemeinschaftlichen Infrastrukturen wie Parks, Bibliotheken oder Nachbarschaftshäusern. Hier wird nicht nur gewohnt, sondern das gemeinsame städtische Leben gestaltet. Allerdings sind auch in Wien die rosigen Zeiten vorbei. Die Finanzialisierung des Wohnraums schreitet auch hier voran (vgl. ARCH+ 244: Wien – Das Ende des Wohnbaus (als Typologie)). Mit wachsender Bevölkerung nehmen auch Diversität und soziale Spannungen zu, weshalb sich die Frage stellt: Wie kann die Stadt verhindern, dass Zugewanderte und sozial Schwächere an den Rand gedrängt werden – und sie damit ihr Versprechen von Integration und sozialer Teilhabe preisgibt? Unter diesen neuen Vorzeichen offenbaren sich auch die Grenzen der Stabilität in der Wiener Stadtentwicklungspolitik: Die starke Regulierung verhindert oft kreative Experimente und individuelle Freiräume – sowohl innerhalb als auch außerhalb der eigenen vier Wände. Architekt*innen beklagen die dadurch entstehende Monotonie, während Bewohner*innen sich als bloße Konsument*innen paternalistischer Fürsorge statt als aktive Mitgestaltende ihres Lebensraums erleben. Die Herausforderung lautet daher: Wie wird Wien in Zukunft nicht nur verwaltete, sondern auch gemeinsam gestaltete Stadt sein? Rom – die Stadt des Gemeinschaffens Hier kommt Rom als Gegenmodell ins Spiel. Die Stadt ist geprägt von jahrzehntelanger Vernachlässigung durch öffentliche Institutionen. Seit ihrer Hauptstadtwerdung Ende des 19. Jahrhunderts sind Spekulation, Verdrängung und sozialer Ausschluss an der Tagesordnung. Doch genau in den Lücken, die dieses Verwaltungsversagen hinterlässt, zeigt sich die Kraft zivilgesellschaftlicher Initiative. Dort, wo die öffentliche Hand sich zurückzieht, entstehen selbstverwaltete Wohnprojekte, kulturelle Freiräume und solidarische Netzwerke. Orte wie Metropoliz (siehe ARCH+ 258: Urbane Praxis), Porto Fluviale oder Spin Time sind lebendige Beweise dafür, dass Stadt auch von unten wachsen kann (? Essay von Rossella Marchini). Aus aufgegebenen Baugruben werden Stadtnatur und Erholungsorte, aus Ruinen werden Orte des Gemeinschaffens, aus leerstehenden Gebäuden werden lebendige Wohnexperimente, in denen Menschen unterschiedlicher Herkunft gemeinsam leben. Diese informellen Strukturen sind mehr als Notlösungen; sie sind Labore für neue Formen des Zusammenlebens. Hier wird ausprobiert, was anderswo undenkbar scheint: solidarisches Wohnen, gemeinschaft- liches Wirtschaften und kulturelle Vielfalt unter einem Dach. Migration wird hier nicht als Problem, sondern als Chance für städtische Erneuerung verstanden. Rom erinnert uns daran, dass Stadt immer auch ein Ort des Aushandelns und der Aneignung ist. Die Ruine wird hier seit jeher nicht als Verlust von Vergangenheit, sondern als Möglichkeit für die Zukunft verstanden. Diese Bottom-up-Ansätze knüpfen dabei an den kulturellen Mythos Roms an. So deuten heutige Aktivist*innen den Mundus – jene rituelle Grube im Zentrum des antiken Roms, in die Neuankömmlinge Opfergaben und Erde aus ihrer Heimat legten, um Mitglieder der Stadtgesellschaft zu werden – als Sinnbild für gelebte Integration und gemeinschaftliche Erneuerung (? Essay von Federica Giardini). Das historische Asylum auf dem Kapitolinischen Hügel – einst Zufluchtsort für Ausgestoßene – lebt in den heutigen selbstverwalteten Räumen weiter. Hier wird Teilhabe nicht über Besitz oder Herkunft definiert, sondern entsteht durch gemeinsames Handeln und solidarisches Engagement. Die Praxis des Commoning ist ein Gegenentwurf zur Kommodifizierung der Stadt. Urbane Gemeingüter sind Modelle für eine soziale Infrastruktur, die nicht top-down geplant, sondern gemeinsam hervor- gebracht und bewirtschaftet wird. Sie demonstriert, dass gemeinschaftliche Stadtproduktion eine tragfähige dritte Säule neben Markt und Staat sein kann. Lernen von … Wien und Rom stehen für zwei unterschiedliche urbane Realitäten: Hier eine Stadt, die Gemeinwohl durch Regulierung und Paternalismus zu sichern versucht; dort eine Kommune, in der Gerechtigkeit durch Improvisation, Widerstand und kollektives Handeln immer wieder neu erkämpft wird. Doch beide Städte zeigen: Urbanität entsteht in der Balance zwischen Fürsorge und Emanzipation. Wien könnte von Rom lernen, mehr Raum für offene Prozesse und unvorhersehbare, gemeinschaftliche Initiativen zuzulassen. Die Stadtentwicklungs- und Wohnbaupolitik sollte sich von einer reinen Versorgungslogik lösen und stattdessen einen Ermöglichungsansatz verfolgen. Rom hingegen braucht eine öffentliche Hand, die das von den sozialen Bewegungen eingeforderte Gemeinwohl als langfristiges politisches Ziel übernimmt – eine Verwaltung, die informelle Prozesse nicht als Störung begreift, sondern als wertvolles Korrektiv ihrer eigenen institutionellen Defizite anerkennt und stärkt. Diese Gegenüberstellung im Österreichischen Pavillon der Architekturbiennale Venedig 2025 eröffnet einen erkenntnisfördernden Dialog zwischen zwei Arten der urbanen Intelligenz, die auf den ersten Blick unvereinbar erscheinen. Die Kurator*innen Michael Obrist, Sabine Pollak und Lorenzo Romito nennen ihren Beitrag Agency for Better Living – und diese Agency ist im doppelten Sinne zu verstehen: Architektur und Stadtentwicklung sind die kollektive Suche nach einem besseren Leben für alle. Dieser Ansatz erfordert, dass den Menschen, die Städte gestalten, beleben und immer wieder reproduzieren, Handlungsmacht – agency – eingeräumt wird. Aber er erfordert auch, dass die, die in ihrem Auftrag handeln – die Verwaltungen und Behörden im engeren Sinne der agency – die Instrumente der Stadtplanung gemeinwohlorientiert einsetzen. Damit Städte sich materiell und Gemeinschaften sich sozial regenerieren können, sind statt rigider Planungen offene und anpassungsfähige Prozesse notwendig. In einer Zeit, in der soziale Spannungen zunehmen, weil immer mehr Menschen vom Recht auf Stadt ausgeschlossen werden, muss die transformative Kraft der Architektur neu ins Bewusstsein gerückt werden: Sie ist weit mehr als bloße Behausung. Gelingende Architektur schafft Räume, die Gemeinschaft ermöglichen, Solidarität fördern und Vielfalt zulassen. Vor diesem Hintergrund sind die Konzepte von Wien und Rom nicht als Gegensätze zu verstehen, sondern als zwei komplementäre Seiten derselben Medaille. Der eine Weg bietet Stabilität und Sicherheit, der andere zeigt, wie wichtig Flexibilität und Eigeninitiative sind. Gemeinsam weisen sie den Weg in eine urbane Zukunft, in der Teilhabe und Verantwortung Hand in Hand gehen. Das Recht auf Wohnen ist dabei weit mehr als der Anspruch auf ein Dach über dem Kopf – es ist das Anrecht darauf, die Stadt zu bewohnen. Die imaginäre Begegnung zwischen Wien und Rom im Österreichischen Pavillon eröffnet einen Möglichkeitsraum, der mehr ist als ein Kompromiss: Er könnte das Fundament für eine neue europäische Stadtentwicklungspolitik bilden, die Gemeinschaffen, Migration und soziale Gerechtigkeit als zentrale Elemente der Stadtgestaltung versteht. In diesem Spannungsfeld kann die Suche nach dem besseren Leben beginnen. Dank Diese Ausgabe ist gemeinsam mit den Kurator*innen Michael Obrist, Sabine Pollak und Lorenzo Romito des österreichischen Beitrags für die Architekturbiennale Venedig 2025 entstanden. Sie dient als Katalog zur Ausstellung Agency for Better Living im Österreichischen Pavillon. Für die kenntnisreiche und kollegiale Gastredaktion danke ich dem kuratorischen Team und allen Beitragenden von Herzen. Mein Dank gilt ebenso dem ARCH+ Team, das in sehr kurzer Zeit das Projekt realisiert hat – allen voran Victor Lortie (Projektleitung), Nora Dünser (CvD) sowie Mirko Gatti, Markus Krieger, Daniel Kuhnert und Sergen Yener.
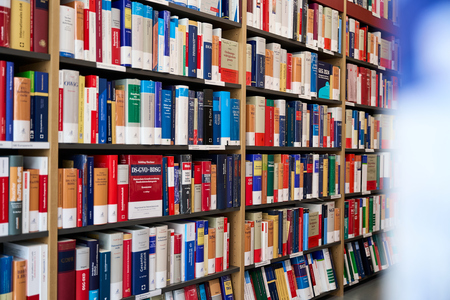
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen
