"Ungesunde Lesewuth" in Basel
Produktnummer:
18b23073d8bd2d4e6fb4852b0da54085c9
| Themengebiete: | Basel Bibliothek Bibliothekar Bibliotheksgeschichte Buchgeschichte Klosterbibliothek Lesegesellschaft Schweiz Universitätsbibliothek Öffentlichkeit |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 20.11.2006 |
| EAN: | 9783796522451 |
| Auflage: | 1 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 155 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Herausgeber: | Barth, Robert |
| Verlag: | Schwabe Verlagsgruppe AG Schwabe Verlag |
| Untertitel: | Allgemeine Bibliotheken der GGG 1807-2007 |
Produktinformationen ""Ungesunde Lesewuth" in Basel"
Bibliotheken «für das Volk» entstanden zaghaft in der Zeit der Aufklärung. Zwar kennen wir in Europa Kloster–, Fürsten- und Universitätsbibliotheken seit dem Mittelalter, doch Büchersammlungen, bestimmt für die Belehrung und Unterhaltung breiter Bevölkerungsschichten, kamen erst richtig im 19. Jahrhundert auf. Dabei handelte es sich anfangs um einfache Bücherausgabestellen mit wenigen Öffnungsstunden. Der Besuch erfolgte nach Geschlecht, Alter und sozialer Schicht getrennt (Jugend–, Bürger- und Arbeiterbibliothek). Um 1900 entwickelten sich dann in den Schweizer Städten nach angelsächsischen Vorbildern eigentliche Öffentliche Bibliotheken mit Lesesälen und Aufenthaltsräumen. Am Ende des 20. Jahrhunderts sind daraus intensiv genutzte Multimediazentren geworden, mit eigenen Kulturprogrammen und einem breiten Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Allgemeinen Öffentlichen Bibliotheken weisen meist die höchsten Besucherzahlen aller städtischen Kulturinstitutionen auf und haben die grösste Breitenwirkung. Am Beispiel der Allgemeinen Bibliotheken der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel, der vermutlich ältesten kontinuierlich bestehenden Allgemeinen Öffentlichen Bibliothek überhaupt, wird diese Entwicklung während 200 Jahren in fünf Etappen nachgezeichnet. Besonderes Gewicht legt das Autorenkollektiv dabei auf die Motivationen, die zur Gründung der Jugend-, Bürger- und Arbeiterbibliotheken geführt haben. Aber auch die Besonderheit, dass ein philanthropischer Verein während rund 120 Jahren eine zentrale städtische und kulturelle Dienstleistung alleine getragen hat, wird deutlich gemacht. Eingeleitet wird der Band durch einen Vergleich mit der Entwicklung in anderen europäischen Ländern. Der Text wird ergänzt durch reiches Bildmaterial aus Vergangenheit und Gegenwart der Bibliotheken und durch zusätzliche thematische Kästchen, die sich unter anderem mit der Lesefähigkeit der Bevölkerung, populären Lesestoffen, Lesegesellschaften, Lesestoffdistribution und dem Bibliothekarberuf von heute befassen. Bibliotheken «für das Volk» entstanden zaghaft in der Zeit der Aufklärung. Zwar kennen wir in Europa Kloster–, Fürsten- und Universitätsbibliotheken seit dem Mittelalter, doch Büchersammlungen, bestimmt für die Belehrung und Unterhaltung breiter Bevölkerungsschichten, kamen erst richtig im 19. Jahrhundert auf. Dabei handelte es sich anfangs um einfache Bücherausgabestellen mit wenigen Öffnungsstunden. Der Besuch erfolgte nach Geschlecht, Alter und sozialer Schicht getrennt (Jugend–, Bürger- und Arbeiterbibliothek). Um 1900 entwickelten sich dann in den Schweizer Städten nach angelsächsischen Vorbildern eigentliche Öffentliche Bibliotheken mit Lesesälen und Aufenthaltsräumen. Am Ende des 20. Jahrhunderts sind daraus intensiv genutzte Multimediazentren geworden, mit eigenen Kulturprogrammen und einem breiten Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Allgemeinen Öffentlichen Bibliotheken weisen meist die höchsten Besucherzahlen aller städtischen Kulturinstitutionen auf und haben die grösste Breitenwirkung. Am Beispiel der Allgemeinen Bibliotheken der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel, der vermutlich ältesten kontinuierlich bestehenden Allgemeinen Öffentlichen Bibliothek überhaupt, wird diese Entwicklung während 200 Jahren in fünf Etappen nachgezeichnet. Besonderes Gewicht legt das Autorenkollektiv dabei auf die Motivationen, die zur Gründung der Jugend-, Bürger- und Arbeiterbibliotheken geführt haben. Aber auch die Besonderheit, dass ein philanthropischer Verein während rund 120 Jahren eine zentrale städtische und kulturelle Dienstleistung alleine getragen hat, wird deutlich gemacht. Eingeleitet wird der Band durch einen Vergleich mit der Entwicklung in anderen europäischen Ländern. Der Text wird ergänzt durch reiches Bildmaterial aus Vergangenheit und Gegenwart der Bibliotheken und durch zusätzliche thematische Kästchen, die sich unter anderem mit der Lesefähigkeit der Bevölkerung, populären Lesestoffen, Lesegesellschaften, Lesestoffdistribution und dem Bibliothekarberuf von heute befassen.
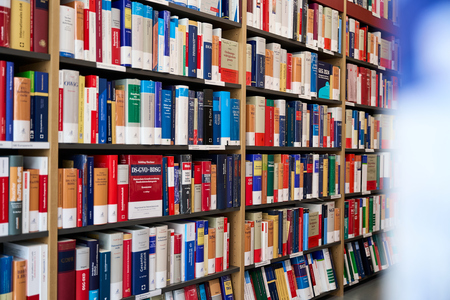
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen
