Flucht und Vertreibung aus Ostpreußen
Patzer, Julian
Produktnummer:
186b185e7bc9134f9197eaab76753e72e4
| Autor: | Patzer, Julian |
|---|---|
| Themengebiete: | Flucht Frische Nehrung Kinder und Jugendliche Krieg Königsberg Ostpreußen Pillau Winter |
| Veröffentlichungsdatum: | 29.01.2025 |
| EAN: | 9783949150319 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 312 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Fabuloso |
| Untertitel: | Erlebnisse und Nachwirkungen von jungen Menschen auf dem Weg in den Westen. |
Produktinformationen "Flucht und Vertreibung aus Ostpreußen"
Hauptbeschreibung I. Einleitung Es gibt wohl kaum eine Familie in Deutschland, die nicht unmittelbar in ihrer Familiengeschichte Angehörige hatte oder hat, die aus den ehemaligen Deutschen Ostgebieten stammten. Die Geschichte von Flucht und Vertreibung der Menschen aus den Deutschen Ostgebieten ist eine Vergangenheit, die uns alle angeht. Der Einfluss der Ostdeutschen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ist und war groß. Noch heute begegnen wir tagtäglich Spuren, die an die Ostgebiete und ihre reiche Kultur erinnern. Denken wir doch einmal an die vielen Straßennamen, die nach den Ostgebieten oder ihren Städten nach dem Krieg benannt wurden. Auch kulinarische Erinnerungen wie die Königsberger Klopse, das Schlesische Himmelreich oder die Pommersche Leberwurst sind immer noch allgegenwärtig. Die Traditionen und die Kultur wurden auch von sogenannten Landsmannschaften, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gründeten, bewahrt. Diese Vertriebenenorganisation, die es von jeder Region des Deutschen Ostens gibt, sind daher immer noch für die damaligen Heimatvertriebenen und auch wieder für ihre Nachkommen identitätsstiftend. Meine Vorfahren stammen aus so gut wie jeder Region des Deutschen Ostens. Egal ob aus Schlesien, Pommern, Posen, dem Sudetenland oder aus Ostpreußen, meine Wurzeln liegen größtenteils hinter Oder und Neisse. Obwohl ich die zweite (Vaters Seite) oder dritte Generation (Mutters Seite) nach der sogenannten Erlebnisgeneration bin, fasziniert und interessiert mich schon seit meiner Kindheit die Geschichte meiner Familie und die des Deutschen Ostens. Vielleicht kam mein Interesse mit dem mangelnden Wissen über die Ahnen, die östlich von Oder und Neiße beheimatet waren. Nur meine eine Ur-Oma mütterlicherseits und meine Oma väterlicherseits sind seit jeher in Niedersachsen verwurzelt. Der Großteil der Familie ist somit nicht aus meiner Heimat. Ich habe mich schon früh gewundert, wieso es von vielen Familienangehörigen nur einige wenige Fotos gab und diese Fotos nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Heute weiß ich, dass meine Vorfahren oft nicht mehr als ein paar Fotos oder kleine persönliche Dinge auf die Flucht mitnehmen konnten, wenn überhaupt. Manche Vorfahren von mir nahmen auf die Flucht eigentlich nur Essen mit und keine Erinnerungsstücke, da ein halbwegs voller Magen wichtiger war, als sich an Objekten zu erfreuen, wie mir erzählt wurde. Trotzdem fand ich es immer schade, wenn Freunde mir Objekte aus der Familiengeschichte zeigten und ich so etwas so gut wie nicht vorweisen konnte, da es kaum etwas gab. Es ging dabei nicht um den materiellen, sondern nur um den ideellen Wert. Leider gerät der Deutsche Osten in der deutschen Erinnerungskultur, besonders da die Erlebnisgeneration ausdünnt, ein wenig in Vergessenheit. Die Geschichte des Deutschen Ostens müsste noch viel mehr thematisiert werden. Fragt man heute junge Menschen in meinem Alter, wo beispielsweise Ostpreußen liegt oder ob sie Schlesien kennen, wird man in den meisten Fällen keine Antwort bekommen. Der Deutsche Osten ist im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft noch kaum greifbar. Um nur ein Beispiel zu nennen, alle Welt spricht vom Untergang der Titanic im Jahr 1912 mit zirka 1517 Toten, der ohne Zweifel eine Tragödie war, aber der Untergang des Flüchtlingsschiffs „Wilhelm Gustloff“ 1945 war mit seinen 9343 Toten eine deutlich schlimmere Katastrophe, die der Gesellschaft fast nicht mehr präsent ist.1 Daher finde ich, dass die Flucht und Vertreibung aus dem Deutschen Osten wieder mehr Raum in der Gesellschaft bekommen sollte. Wichtig ist dabei Heimatkunde zu prägen und Heimattraditionen zu pflegen und das ganz ohne revanchistische Hintergedanken. Der Historiker Andreas Kossert, der unter anderem die Bücher „Ostpreussen“, „Kalte Heimat“ und „Flucht“ verfasst hat, thematisiert darin mitunter das Thema Flucht und Vertreibung aus dem Deutschen Osten, die Ankunft im Westen und die Eingliederung der Heimatvertriebenen im heutigen Gebiet der Bundesrepublik. Kosserts Werke werden in dieser Arbeit auch eine wichtige Rolle spielen und auch einen Schwerpunkt setzen. Zu Flucht und Vertreibung aus dem Deutschen Osten entstanden bereits seit dem Ende des Krieges zahlreiche Publikationen. Heutzutage findet man somit eine Vielzahl von Monographien und Sammelbänden, die dieses Thema behandeln. Auch viele Zeitzeugenberichte und Quellensammlungen wurden besonders in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg zusammengetragen. Besonders erwähnenswert ist dabei der erste Band von Theoder Schieder mit dem Namen „Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa“, der in dieser Arbeit ebenso eine wichtige Rolle spielen wird. In meiner Bachelorarbeit soll es aber nicht um den gesamten Deutschen Osten gehen, da dieser Bereich zu groß gefasst wäre, sondern nur um Ostpreußen. Die Provinz Ostpreußen war zwar lange Zeit kaum von Kriegseinwirkungen betroffen, dafür wurde sie aber mit dem Einmarsch der Roten Armee am 16. Oktober 1944 und der Zunahme der Luftangriffe ab dem Sommer 1944, umso schwerer getroffen. Da die Rote Armee mit dem Einmarsch in Ostpreußen erstmals deutschen Boden betrat, wurde Ostpreußen mit seiner Bevölkerung besonders stark in Mitleidenschaft gezogen. Spätestens mit dem Einmarsch der Roten Armee begannen auch immer mehr Menschen ihre Heimat zu verlassen. Einige Menschen waren bereits vor dem Einmarsch aus ihrer Heimat geflohen und konnten ohne viele Hindernisse Ostpreußen verlassen, für andere Bewohner wiederum wurde die Flucht zur vielleicht größten Hürde ihres Lebens, da für sie die Flucht zu spät begann. Viele Ostpreußen wurden von der Roten Armee immer weiter eingekesselt und auf der Flucht eingeholt. Nicht nur die Rote Armee im Nacken und die erschwerten Fluchtbedingungen, sondern auch der harte Winter 1945 wurde für viele Ostpreußen zur Zerreißprobe.2 „Von den 2,4 Millionen Menschen, die Anfang 1944 in Ostpreußen lebten, unternahmen etwa 1,8 Millionen einen Fluchtversuch vor der heranrückenden Roten Armee.“3 Unter allen deutschen Provinzen musste Ostpreußen die höchsten Menschenverluste erleiden. Zirka eine halbe Million Ostpreußen überlebten den Krieg und seine Folgen nicht. Wenn man bedenkt, dass Ostpreußen im Jahr 1939 zirka 2,49 Millionen Einwohner hatte, ist die Zahl der Todesopfer im Verhältnis gewaltig.4 „Flucht, Verschleppung, Lager, Vertreibung, Hunger und Kälte: Diese Erfahrungen standen für das letzte Kapitel Ostpreußens.“5 „An dessen Ende versanken siebenhundert Jahre deutscher Geschichte zwischen Weichsel und Memel unter den Trümmern des Dritten Reiches.“6 „Vierzehn Millionen deutsche Vertriebene treffen nach Kriegsende in Restdeutschland ein, ein kleiner Teil in Österreich“, daran lässt sich das Ausmaß dieser Bevölkerungsverschiebung erahnen.7 In meiner Bachelorarbeit liegt der Fokus auf den jungen Menschen aus Ostpreußen, die all diese Geschehnisse mehr oder weniger erlebt haben. Die Schicksale der Heimatvertriebenen sind sehr facettenreich. Jeder Mensch erlebte die Flucht und Vertreibung anders und nahm sie auch unterschiedlich wahr. Obwohl die Flucht und Vertreibung immer individuell erlebt wurde, gab es unter den Heimatvertriebenen aber auch gewisse Muster, die in dieser Arbeit näher erforscht werden. In meiner Bachelorarbeit sollen von diesen Millionen Fluchterfahrungen, einige näher untersucht werden. Daher habe ich im Rahmen dieser Forschungsarbeit vier Zeitzeugeninterviews mit Menschen durchgeführt, die damals in jungen Jahren aus ihrer Heimat Ostpreußen geflohen sind. Eines der Interviews habe ich mit zwei Schwestern durchgeführt, daher wird dieses Interview auch nur zusammen ausgewertet. Ich habe zu meinen Zeitzeugen ein sehr gutes Verhältnis. Inge Teiwes beispielsweise ist meine Tante, Ingeborg Eggers, Gisela Ehrenberg, Günther Grigoleit und Ilse Kuhrau kenne ich durch die Landsmannschaft Ostpreußen – Gruppe Holzminden, in der ich, durch mein großes Interesse an Ostpreußen, seit 2017 Mitglied bin. Durch meine langjährige Mitgliedschaft konnte ich über die Zeit teilweise enge freundschaftliche Beziehungen zu den Mitgliedern aufbauen. Für mich sind die Treffen der Landsmannschaft Ostpreußen – Gruppe Holzminden immer ganz besondere Momente, die mir sehr viel bedeuten. Umso glücklicher bin ich, dass vier dieser Mitglieder sich sofort für ein Interview bereit erklärt haben. Alle Zeitzeugen wurden mit den gleichen Fragen interviewt. Dadurch kann man die Aussagen, Emotionen und Erlebnisse besser miteinander vergleichen. Es wird also eine Forschungsarbeit werden, die sich primär mit Quellen in Form von Zeitzeugeninterviews und Monographien beschäftigt. Die Interviews sollen den Grundstein der Arbeit legen. Im Fokus steht dabei, wie die Zeitzeugen die Flucht aus Ostpreußen erlebt haben, welche Emotionen sie hatten, was für Ängste und Probleme sie vielleicht überwinden mussten und wie sie die Ankunft im Westen erlebten. Viele der Quellen, die man in der Literatur findet, sind aber Zeitzeugenberichte von Ostpreußen, die damals als Erwachsene die Flucht und Vertreibung aus Ostpreußen miterlebt haben. Nur wenige Quellen handeln von Erlebnissen von damals jungen Menschen. Daher müssen zum Teil auch Aussagen von damals Erwachsenen mit herangezogen werden. Besonders in den letzten Jahren entstanden aber auch viele Autobiografien von älteren Menschen, die ihre Erinnerungen an die Flucht und Vertreibung, die sie als junge Menschen erlebten, aufschrieben. Neben den Quellen möchte ich mit der jeweiligen Fachliteratur die Aussagen der Zeitzeugen bestätigen, widerlegen und kritisch untersuchen. Die Bachelorarbeit wird unter folgender Fragestellung bearbeitet: „Wie erlebten junge Menschen aus verschiedenen Regionen Ostpreußens die Flucht und Vertreibung in den Westen und wie prägten diese Erlebnisse das weitere Leben? Welche Schicksale mussten sie durchleben und wie war ihre Ankunft in der neuen Heimat?“ Ich möchte somit auch herausfinden, was die Gedanken, Gefühle, Ängste und Sorgen der Menschen während der Flucht und in der neuen Heimat waren. Unter den verschiedenen Lebenslinien sollen somit Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet werden. Der untersuchte Zeitraum wird seinen Schwerpunkt in der Zeit zwischen dem Sommer 1944 und dem Jahr 1948 haben, als die letzten untersuchten Zeitzeugen schließlich im Westen ankamen. Ebenso wird auch ansatzweise das weitere Leben und die Integration nach der Ankunft im Westen thematisiert. Die Arbeit ist chronologisch gegliedert. Auf den ersten Seiten meiner Arbeit werde ich meine Interviewpartnerinnen und -partner kurz chronologisch nach ihren Geburtsjahren vorstellen. Dadurch soll sich der Leser schon einmal ein Bild von den Personen machen. Danach werden die Vorfluchtmomente der Menschen und die ersten Evakuierungsmaßnahmen in Ostpreußen thematisiert. Dabei werden auch die schweren Luftangriffe auf Königsberg im August 1944 eine Rolle spielen. Im Hauptteil der Arbeit wird die Flucht in den Westen näher untersucht. In diesem Teil werden allgemein die wichtigsten Fluchtmöglichkeiten, wie beispielsweise über das zugefrorene Frische Haff oder über den Seeweg erläutert. Zum einen wird also über die Bandbreite von Fluchtmöglichkeiten geschrieben, wie ein Großteil der Bevölkerung geflohen war, aber es wird auch individuell geschaut, was die interviewten Zeitzeugen berichteten. Ebenso werden auch die Gräueltaten der Sowjets thematisiert und wie die Deutschen darunter gelitten haben. Anschließend wird auch ein Blick auf die dänischen Flüchtlingslager geworfen, in denen hunderttausende von Deutschen jahrelang interniert waren. Danach geht es um die Ankunft der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen im Westen. In diesem Punkt werde ich genauer untersuchen, wie die Ankunft für die Menschen war, wie die Flüchtlinge die neue Umgebung wahrnahmen, wie die Einheimischen die Heimatlosen behandelten und wann sich die Menschen in der neuen Umgebung integriert fühlten. Die nächsten Punkte hinterfragen schließlich, wie die Flucht und Vertreibung das weitere Leben der Menschen geprägt hat und wie stark die Rückkehrhoffnung in die Heimat in der Nachkriegszeit wirklich war. Ebenso wird auch die Heimatpflege der Vertriebenen und die Rückkehr nach der Wende thematisiert. Zum Schluss wird noch geschaut, ob die Zeitzeugen ihr jetziges Zuhause auch als zweite Heimat oder als neue Heimat ansehen oder ob für sie Ostpreußen immer noch die einzig wahre Heimat bleibt. Gerade diese Frage wirft einen sehr emotionalen Blick auf ihre Gefühlslage. Am Ende der Arbeit wird ein Fazit gezogen, indem ich meine Ergebnisse noch resümiere und zusammenfasse und dabei auch einen Ausblick geben. Bevor ich inhaltlich beginne, möchte ich vorab ein paar grundlegende Definitionen zu Flucht und Vertreibung klären. „Die Flucht zu ergreifen, ist eine freie Entscheidung, die aufgrund bedrohlicher äußerer Umstände getroffen wird. […] Todesangst ist wohl der wichtigste Grund für den Entschluss, die vertraute Umgebung zu verlassen. Vertriebene hingegen werden gegen ihren Willen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.“8 „Wer nicht rechtzeitig flieht, liefert sich womöglich der Willkür anderer aus. Die Übergänge sind oft fließend, und so können Flüchtlinge am Ende zu Vertriebenen werden.“9 „Angst, Hoffnungslosigkeit und Erschöpfung, das ist es, wovon man in den Berichten von Flüchtlingen vor allem liest.“10 „Vertreibung macht aus Menschen Objekte fremden Willens. Ohnmächtig sind sie ihren Gegnern ausgeliefert.“11 Mit Blick auf die Flucht und Vertreibung aus Ostpreußen und aus anderen Vertreibungsgebieten muss erläutert werden, dass der Begriff Vertreibung sich nicht nur auf die brutalen Vertreibungen im Sommer und Herbst 1945, sondern auch auf die Evakuierung der deutschen Bevölkerung ab dem Herbst 1944, die Flucht im Frühjahr 1945 und auch auf die ab 1946 durchgeführten Zwangsumsiedlungen bezieht. Die Bezeichnung „Vertreibung“ ist also ein vielschichtiger Begriff. Im Prinzip sind also alle Menschen, die damals durch den Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verlassen haben oder mussten zu Vertriebenen geworden. Denn diese Menschen wollten nach dem Krieg wieder in ihre Heimat zurückkehren.12 „Sie wurden jedoch von den sowjetischen und polnischen Behörden daran gehindert und eben deshalb zu Vertriebenen gemacht.“13 Leseprobe XII. Fazit Das Thema Flucht und Vertreibung aus Ostpreußen, mit der Ankunft und Integration im Westen ist ein Themenfeld, was sich eigentlich nicht im Rahmen einer Bachelorarbeit untersuchen lässt. Auch wenn vieles in dieser Arbeit nicht angesprochen werden konnte, weil es sonst den Rahmen gesprengt hätte, gibt die Arbeit die Geschehnisse und Emotionen in Ostpreußen und auf der Flucht ab dem Sommer 1944 bis zur Ankunft im Westen wieder. Den Schwerpunkt dieser Bachelorarbeit sollten die Zeitzeugeninterviews und auch andere Erlebnisberichte aus den Quellen bilden. Dass ich zu meinem Thema noch Zeitzeugen interviewen konnte, war großes Glück, da diese Interviews, wie ich finde, wahre historische Schätze sind. So schön wie die Interviews auch jetzt geworden sind, so arbeitsintensiv waren sie auch in ihrer Vorbereitung, Durchführung und besonders bei der Transkription. Ich bin Ingeborg Eggers, Gisela Ehrenberg, Günther Grigoleit, Ilse Kuhrau und Inge Teiwes zu großem Dank verpflichtet. Über ein schmerzliches Thema, so offen mit mir zu sprechen, muss für meine Zeitzeugen auch nicht einfach gewesen sein. Ich hatte auch noch eine andere Zeitzeugin interviewen wollen, die schaffte es aber nicht mehr mental, über die fürchterlichen Ereignisse ihrer Flucht zu sprechen. Das Pendant zu den Quellen lieferte die Fachliteratur, die die Geschehnisse einordnen, bestätigen oder widerlegen sollte. Der Fokus meiner Bachelorarbeit lag somit darauf, wie damals junge Menschen die Flucht und Vertreibung aus Ostpreußen in den Westen erlebten und wie diese Ereignisse ihr weiteres Leben prägten. Ebenso wollte ich herausfinden, welche Schicksale sie durchleben mussten und wie sich ihre Ankunft und die Integration in der neuen Heimat im Westen gestaltete. Zentral waren dabei somit die Gedanken, die Gefühle, die Ängste und auch die Sorgen der jungen Ostpreußen, die sie noch in der Heimat, auf der Flucht und nach Ankunft im Westen hatten. Das große Problem war dabei nur, dass man in der Fachliteratur kaum Einblicke in Emotionen und Gefühlslagen der Menschen aus Ostpreußen, geschweige denn von damals jungen Menschen bekam. Die Fachliteratur ist selbstverständlich sehr sachlich und objektiv geschrieben und beschreibt nur selten die Stimmungslagen und Gefühle der Bevölkerung während der Flucht. Auch in den zahlreichen Quellen der Fachliteratur, in denen die Menschen ihre Fluchterlebnisse schilderten, konnte ich überwiegend feststellen, dass sie das Erlebte fast immer nur sehr objektiv beschrieben und nur wenig Emotionen zeigten. Meine Interviewpartnerinnen und -partner gaben mir hingegen Auskunft über ihre Emotions- und Gefühlslagen. Zusammenfassend kann ich also festhalten, dass ich durch die Literatur nicht sonderlich viel zu Emotionen und Gefühlen der Betroffenen erfahren konnte. Ich hätte mir da mehr aufschlussreiche Literatur erhofft. Oftmals musste ich daher auch damals Erwachsene Zeitzeugen mit heranziehen, da ich eben nicht genug junge Ostpreußen in der Literatur fand. Die Menschen, die die Flucht und Vertreibung aus Ostpreußen bewusst miterlebten, haben oftmals nach dem Krieg auch nicht viel oder gar nicht über das Erlebte gesprochen. Von meinen Eltern weiß ich, dass unsere Familie die Flucht und Vertreibung aus dem Osten so gut wie nie angesprochen hat. Es wurde vieles einfach totgeschwiegen. Wahrscheinlich um die schlimmen Momente einfach zu vergessen und zu verdrängen. Die Menschen, die das alles erleben mussten, wollten wahrscheinlich einfach nach dem Krieg positiv und optimistisch nach vorne blicken und nicht nur in der Vergangenheit leben. Tief im Herzen wird aber höchstwahrscheinlich immer der Schmerz über den Verlust der Heimat und das Erlebte gewesen sein. Die meisten Zeitzeugen haben das Erlebte mit sich selbst ausgemacht. Meine interviewten Zeitzeugen haben mir gegenüber zwar sehr offen ihre Erlebnisse geschildert und auch ihren Emotionen und Gefühlen freien Lauf gelassen, trotzdem merkte ich an manchen Stellen der Interviews, dass sie über gewisse Sachen entweder nicht sprechen wollten oder konnten. Insbesondere das Thema „Hygiene“ während der Flucht, war ein sehr sensibles und kritisches Thema. Besonders schwierig müssen die hygienischen Verhältnisse auf den Flüchtlingsschiffen gewesen sein. Ilse Kuhrau beispielsweise wollte über die hygienischen Verhältnisse während ihrer Flucht mit dem Schiff keine näheren Auskünfte geben. Auch Ingeborg Eggers und Gisela Ehrenberg gaben mir in diesem Punkt keine näheren Beschreibungen.577 Ebenso findet man auch bei anderen Zeitzeugenberichten in der Literatur im Prinzip keine detaillierten Beschreibungen zu diesem Thema. Auch in den Flüchtlingszügen müssen ähnlich schwierige Verhältnisse geherrscht haben, die Günther Grigoleit ansatzweise beschrieb.578 Nicht zu vergessen ist auch, dass ein Teil meiner interviewten Zeitzeugen während der Flucht damals schon in der Pubertät war und dass sie vielleicht durch die kaum dagewesene Privatsphäre gewisse Probleme hatten. Darüber verloren sie aber auch kein Wort. Um nochmal auf die Flucht an sich einzugehen: Bei keinem meiner Zeitzeugen war die Flucht aus Ostpreußen im Vorfeld länger beziehungsweise überhaupt geplant gewesen. Bevor für meine Zeitzeugen die Flucht begann, musste alles sehr schnell gehen, da war eine längere Planung gar nicht möglich. Die Flucht ging im Prinzip bei allen Zeitzeugen von jetzt auf gleich los.579 Meinen Zeitzeugen hat man als Kind durch Eltern oder anderen Familienangehörigen nicht direkt erzählt, dass sie fliehen müssen. Vielleicht wollten die Erwachsenen diese Situation selber nicht wahrhaben und deshalb haben sie mit den Kindern erst gar nicht darüber gesprochen. Trotzdem wussten alle meine Zeitzeugen im Prinzip, wieso sie aus ihrer Heimat Ostpreußen fliehen mussten. Inge Teiwes war die einzige Zeitzeugin, die damals noch nicht so richtig wusste, weshalb sie fliehen mussten. Höchstwahrscheinlich ist das dem geschuldet, dass sie eben die Jüngste der Zeitzeugen ist.580 Alle meine Zeitzeugen fühlten sich an der Seite ihrer Familie scheinbar ziemlich sicher und hatten nicht allzu oft Angst während der Flucht.581 Dadurch, dass die Front im Osten in den letzten Kriegsmonaten immer näher rückte und die Rote Armee immer mehr Fluchtrouten abschnitt, entstanden gewisse Fluchtmuster. Die meisten Ostpreußen gelangten besonders gegen Ende des Krieges überwiegend mit dem Schiff in den Westen oder über das zugefrorene Haff. Mit dem Schiff ging es für die Ostpreußen dann entweder nach Dänemark, in die unzähligen Flüchtlingslager oder in weiter westlich gelegene Teile Deutschlands. Die Menschen in den ostpreußischen Städten nahmen bei Fluchtbeginn größtenteils nur das mit, was sie tragen konnten. Die Landbevölkerung machte sich hingegen überwiegend mit Pferd und Wagen, und allem, was auf den Wagen passte, auf die Flucht.582 Zusammenfassend konnte ich feststellen, dass für alle meine interviewten Zeitzeugen die Flucht aus Ostpreußen in jeder Hinsicht ein einschneidendes und prägendes Erlebnis gewesen ist, und was sie emotional auch mal mehr und mal weniger stark geprägt hat. Trotzdem haben meine interviewten Zeitzeugen noch relativ viel Glück auf ihrer Flucht gehabt. Wahrscheinlich auch deshalb, weil der Großteil meiner Zeitzeugen durch ihre größtenteils östliche Lage in Ostpreußen auch noch rechtzeitig fliehen konnten und somit nicht von der Roten Armee überrollt worden. Ein Großteil meiner Zeitzeugen zählte mit zu den ersten Flüchtlingen, die damals aus Ostpreußen evakuiert wurden und somit ihre Heimat für immer verlassen mussten. Keiner meiner Zeitzeugen hatte je Berührungspunkte mit der Roten Armee. Sie blieben alle verschont vor den Gräueltaten der Sowjets. Viele andere Flüchtlinge wurden dagegen, wie ich es in der Arbeit detailliert beschrieben habe, auf verschiedene Weise Opfer der sowjetischen Willkür. Als die Heimatvertriebenen in den Westen kamen, wurden viele von ihnen von den Einheimischen nicht gut behandelt. Zwischen Einheimischen und Heimatvertriebenen entstanden zum Teil große Spannungen. Die Antipathie der Einheimischen gegenüber den Neuankömmlingen war somit weit verbreitet und allgegenwärtig, wie ich bereits geschildert habe. Dass es auch anders ging, bewies der Großteil meiner interviewten Zeitzeugen. Inge Teiwes, Günther Grigoleit und Ilse Kuhrau erlebten bei der Ankunft im Westen keine schlechte Behandlung oder Diskriminierung, ganz im Gegenteil. Ingeborg Eggers und Gisela Ehrenberg hatten zwar dieses eine negative Erlebnis bei dem Bauern in Wegensen, aber bei der Ankunft in Holzminden blieben sie auch von unschönen Erfahrungen verschont. Es gab also Fälle von Diskriminierung, aber nicht jeder musste sie erleben.583 Ich würde aufgrund der Aussagen meiner Interviewpartnerinnen und -partner behaupten, dass sie sich in der neuen Heimat gut in die Gesellschaft integrieren konnten und dass ihr Neuanfang im Westen eine Erfolgsgeschichte war. Natürlich lief im Leben meiner Zeitzeugen nach der Ankunft im Westen nicht alles immer nach Plan, aber sie haben immer das Beste daraus gemacht und sind heute, wie ich bei den Interviews empfand, mit ihrem Leben rückblickend zufrieden. „Mein ganzes Leben bestand aus geschenkten Abenteuern“, blickte beispielsweise Grigoleit auf sein Leben dankbar zurück.584 Trotzdem konnten sie alle ihr vergangenes Leben in Ostpreußen, was sie gezwungenermaßen zurücklassen mussten, zeitlebens, unterschiedlich stark ausgeprägt, nie vergessen. Die Sehnsucht nach der Heimat und der Schmerz über dessen Verlust hat im Leben meiner Zeitzeugen immer eine Rolle gespielt, mal mehr und mal weniger. Ingeborg Eggers und Gisela Ehrenberg fühlen sich heute in Holzminden sehr zuhause und sind in der Gesellschaft integriert. Ebenso gingen sie Jahrzehnte einer geregelten Arbeit nach. Trotzdem konnte Eggers nie ihren Traumberuf als Lehrerin ausüben, da sie dafür hätte studieren müssen und nach dem Krieg im Westen, kein Geld dafür dagewesen ist. Wenn sie nicht hätte flüchten müssen, hätte sie vielleicht Lehrerin werden können.585 Auch Günther Grigoleits Berufswunsch konnte zunächst nicht in Erfüllung gehen und er musste zunächst einen anderen Beruf erlernen. Er wollte ebenso studieren, aber auch seine Familie hatte dafür nach dem Krieg kein Geld. Erst über Umwege wurde er doch noch in späteren Jahren Pastor.586 Ilse Kuhrau wollte Krankenschwester werden und wurde es auch.587 Inge Teiwes fühlt sich heute in ihrer zweiten Heimat, wie sie selber sagte, auch sehr wohl.588 „[Die Eingliederung der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen] war insgesamt eine Erfolgsgeschichte, in Millionen von persönlichen und Familienkarrieren, aber auch in ihrer Gesamtheit als gesellschaftlicher Integrationsprozess.“589 Trotzdem glaube ich, dass im Stillen jeder Ostpreuße, der damals seine Heimat verlassen musste, darauf gehofft hat, eines Tages, auch wenn nur zu Besuch, wieder in die Heimat zurückkehren. Nicht ohne Grund haben so viele Heimatreisen seit der Wiedervereinigung stattgefunden. Auch meine interviewten Zeitzeugen hatten scheinbar diese Sehnsucht, da sie mindestens einmal nach dem Krieg wieder in ihrer Heimat waren.590 Ich bin der festen Überzeugung, dass für den Großteil, wenn nicht sogar fast für alle Ostpreußen, die einzige Heimat immer Ostpreußen blieb. Dieses Empfinden hängt aber auch davon ab, wie viel man von Ostpreußen noch mitbekommen hat, sprich, wann man geboren wurde. Je jünger ein Zeitzeuge ist, desto weniger Emotionen werden wahrscheinlich an Ostpreußen hängen. Inge Teiwes beispielsweise, die die jüngste der Zeitzeugen ist, sieht sowohl Tilsit, als auch Merxhausen als ihre Heimat an. Für alle anderen interviewten Zeitzeugen ist nur Ostpreußen die einzig wahre Heimat.591 Ostpreußen ist heute eine Landschaft, die es so, wie es meine Zeitzeugen erlebten nicht mehr gibt und auch nicht mehr wieder geben wird. Der Untergang Ostpreußens mit seiner reichen Kultur ist die Quittung für einen Krieg, den unsere Vorfahren begannen und mit deren Konsequenzen wir leben müssen. Und trotzdem lebt der Mythos „Ostpreußen“ weiter und auch ich möchte eines Tages das Land der Vorfahren besuchen. Um mit Günther Grigoleits Worten diese Arbeit zu schließen: „Ostpreußen ist ein Land, das man einfach gesehen haben muss, mit seinen Wäldern, seinen Seen, seiner Küste, um ahnen zu können, wie schön es sein kann, da zu leben.“592
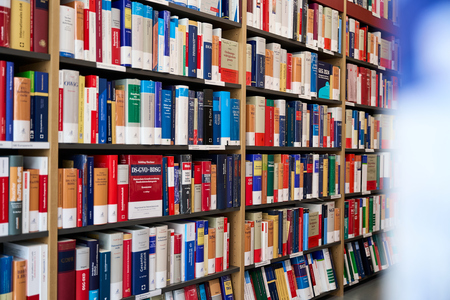
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen
